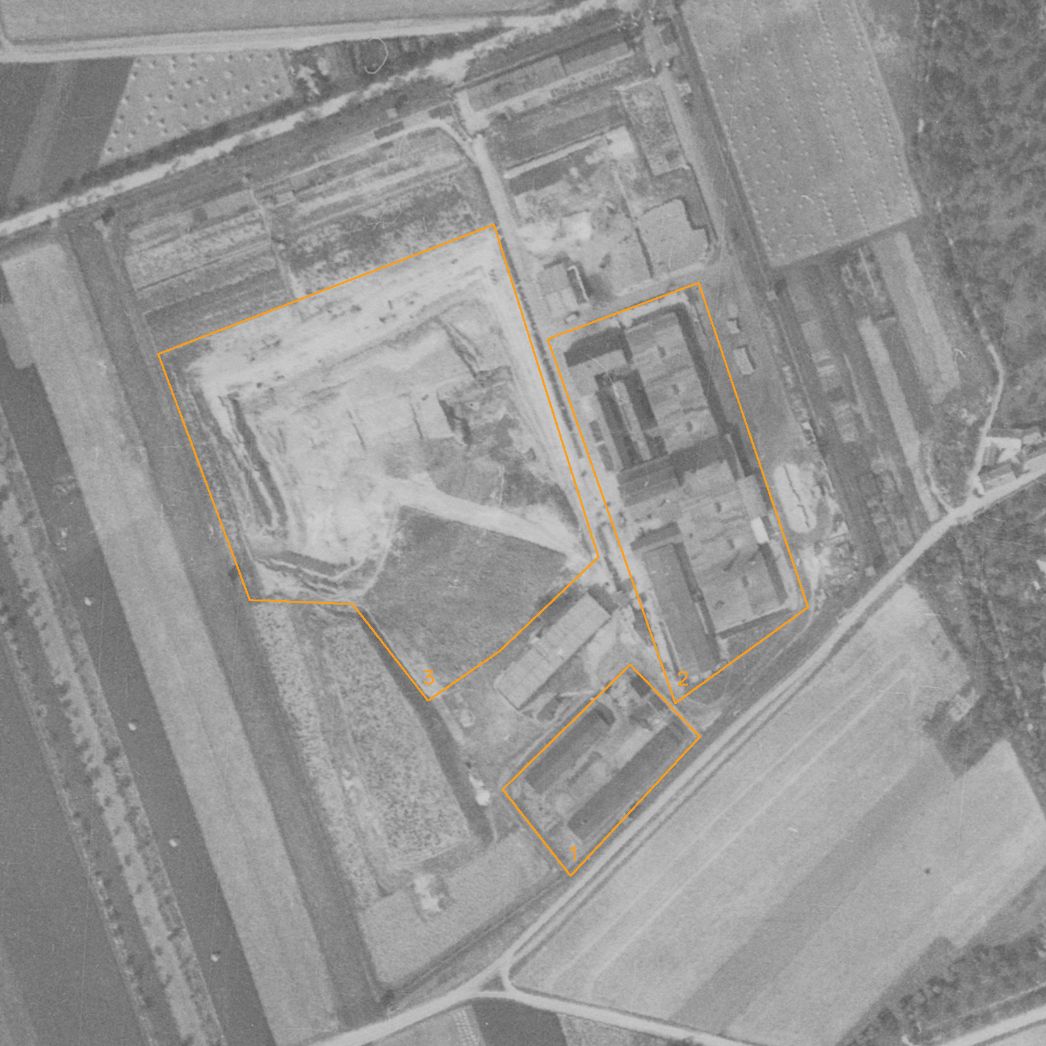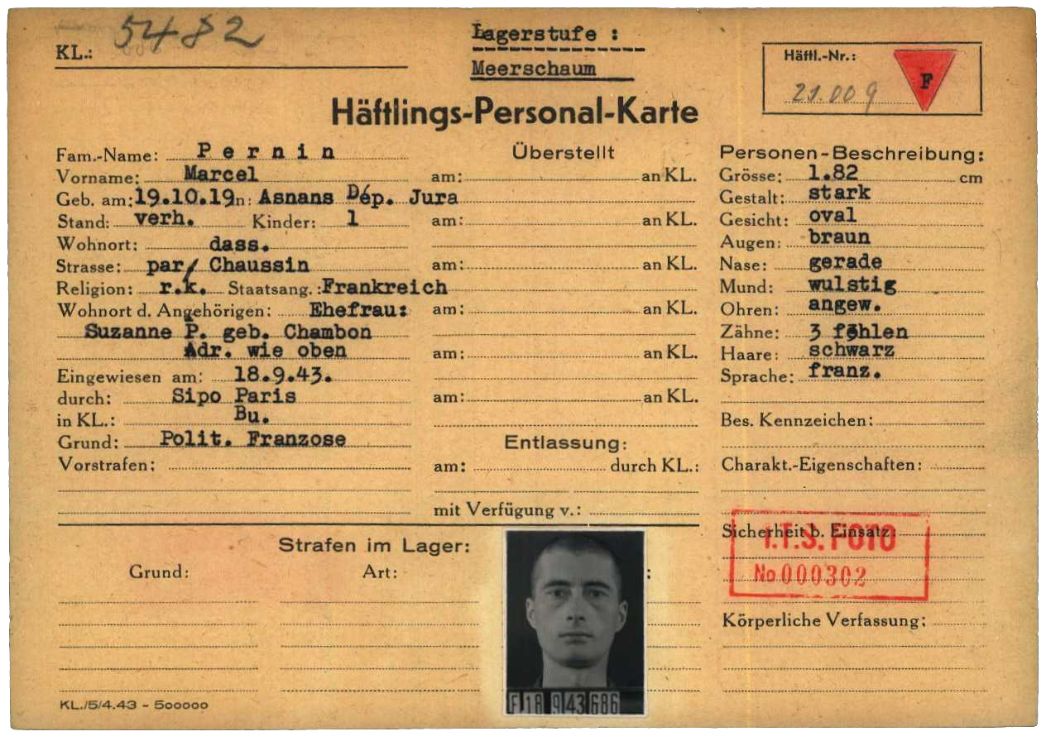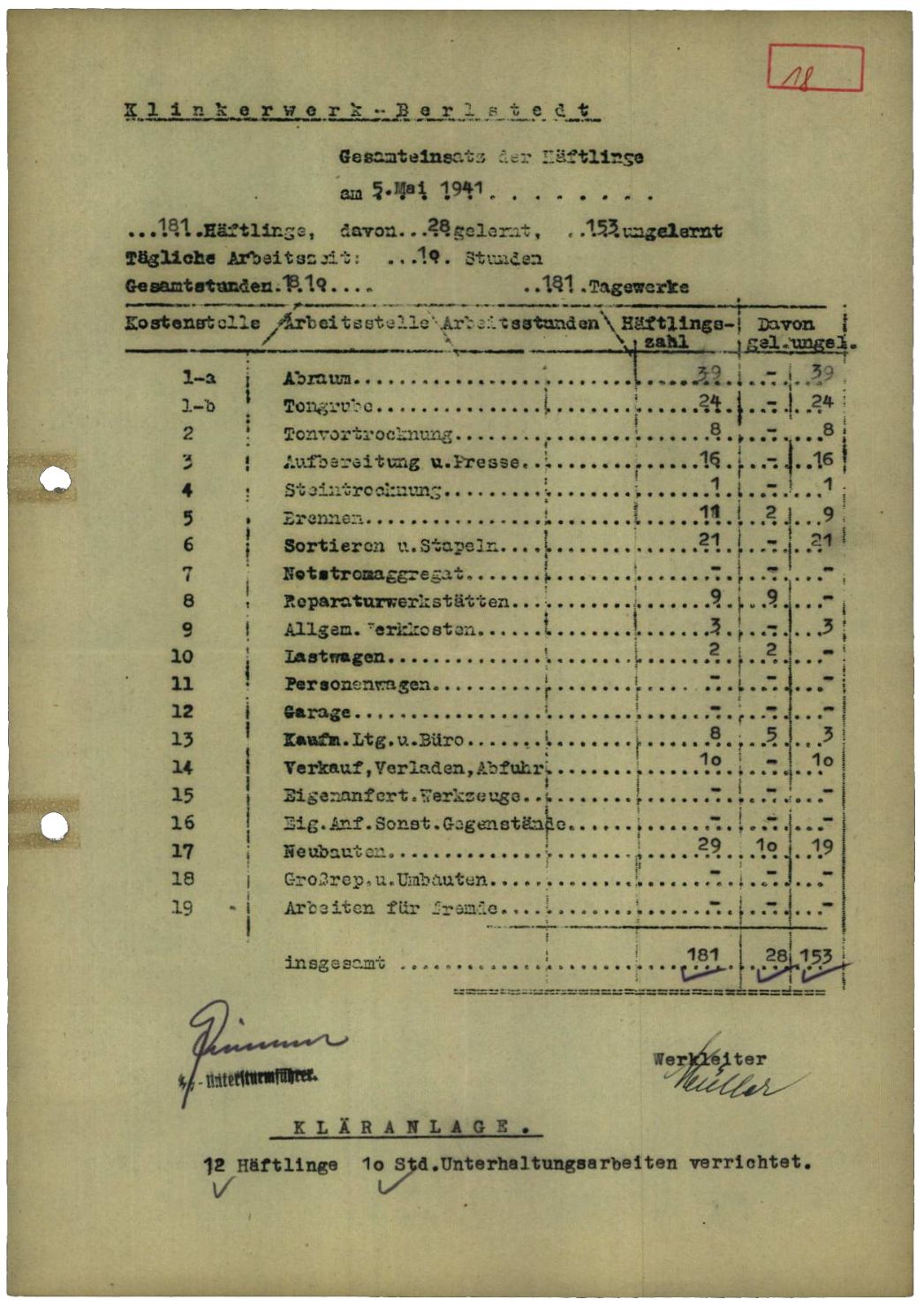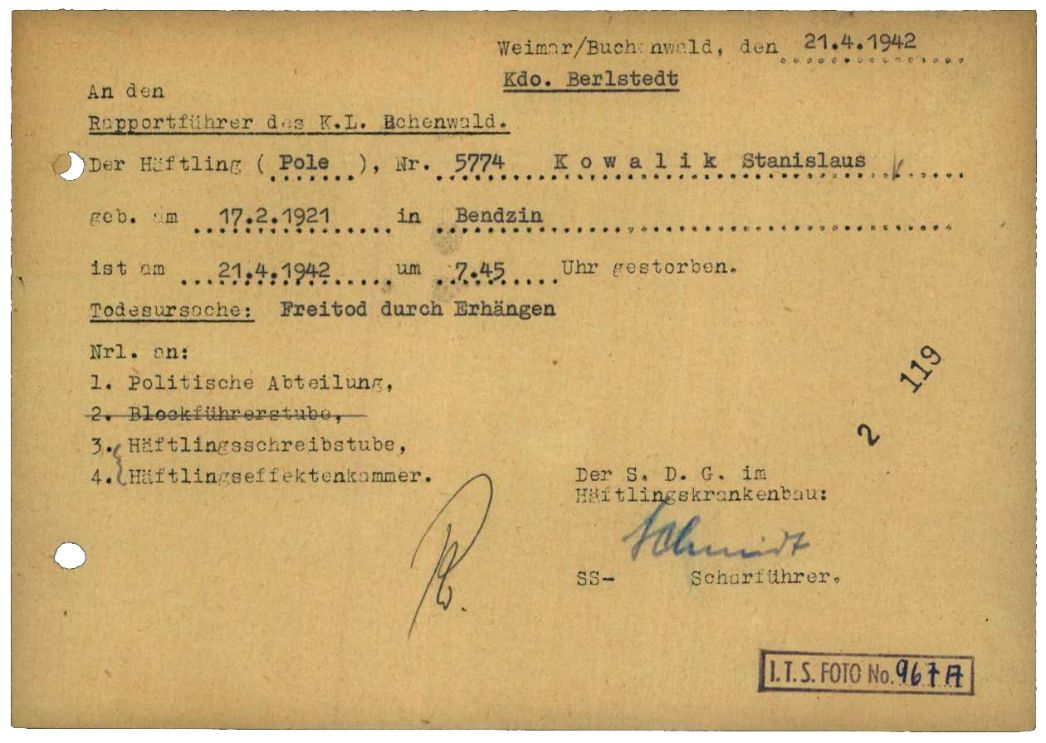Bewachung
Über die Wachmannschaft in Berlstedt liegen bisher nur fragmentarische Informationen vor. Unterschiedliche Kommandoführer waren im Außenlager eingesetzt. Namentlich bekannt ist der SS-Oberscharführer Erich Martin (geb. 1914), der vermutlich in den Jahren 1940 bis mindestens 1942 als Kommandoführer fungierte. Für November 1944 ist ein SS-Oberscharführer namens Jänisch in gleicher Funktion belegt. Eine leitende Funktion in Berlstedt nahm ungefähr zur selben Zeit ein SS-Sturmscharführer namens Strahlberg ein. Die Wachmannschaft umfasste im November 1944 insgesamt 36 SS-Männer. Zahlen für die übrige Zeit liegen nicht vor. Verurteilungen wegen den in Berlstedt begangenen Verbrechen gab es nicht. Ermittlungen führten in den 1970er-Jahren in der Bundesrepublik zu keinem Ergebnis.
Räumung
Aufgrund der heranrückenden US-Armee löste die SS das Außenlager Berlstedt am 4. April 1945 auf. Rund 200 Häftlinge befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch vor Ort. Die SS brachte sie zurück in das Hauptlager Buchenwald. Viele von ihnen verließen in den Tagen danach mit Todesmärschen oder Räumungstransporten Buchenwald.
Literatur:
Christian Wussow, Berlstedt, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 388-392.