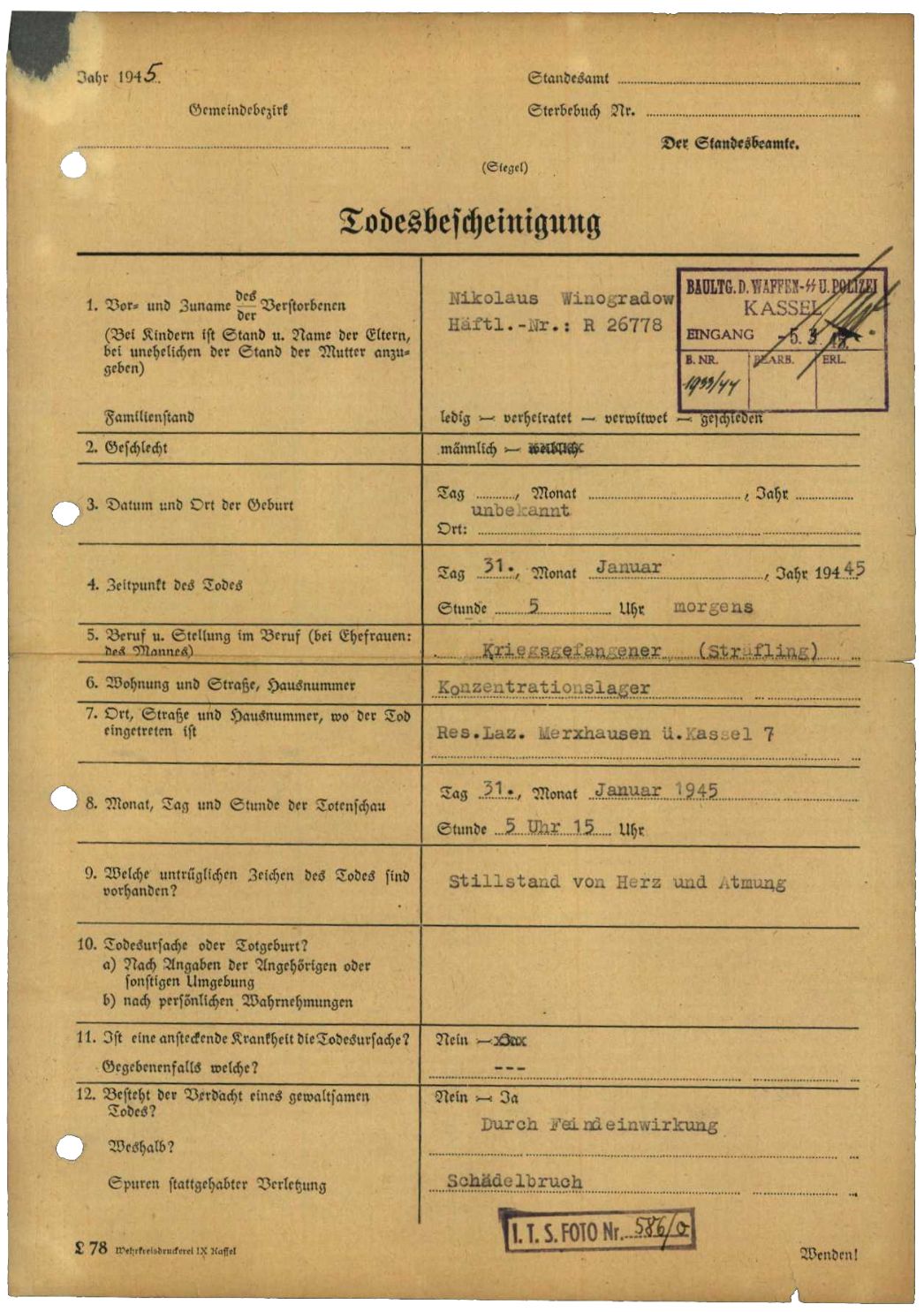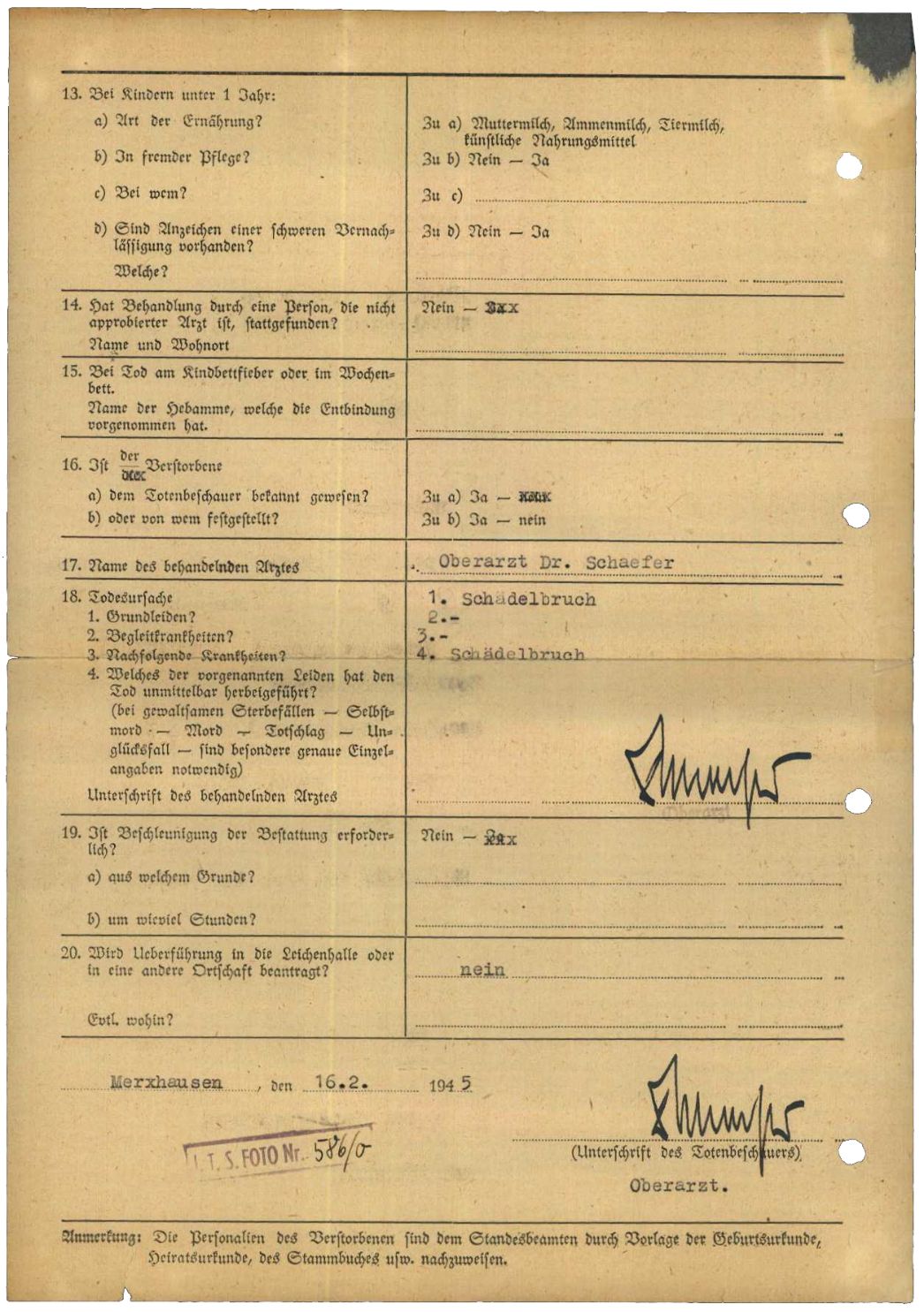Das Lager
Mitte 1943 plante die SS-Bauleitung, mehrere Dienstgebäude für den Höheren SS- und Polizeiführer Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont im Kasseler Stadtteil Wilhelmshöhe (heute Bad Wilhelmshöhe) zu errichten. Für die Bauarbeiten gründete die Buchenwalder SS Anfang Juli 1943 vor Ort ein neues Außenlager. Als Unterkunft mietete sie eine ehemalige Gaststätte außerhalb der Stadt im Druseltal 85. Der Fachwerkbau hatte zuvor als Lager für französische Kriegsgefangene gedient und war deshalb mit einem dreieinhalb Meter hohen Stacheldrahtzaun, Stolperdraht und Fenstergittern gesichert. Das Gebäude, in dem neben dem Hauswirt auch die Wachmannschaft schlief, unterteilte sich in mehrere Bereiche. Für die Häftlinge gab es einen Schlafraum, sanitäre Anlagen und einen Tagesraum. Die notdürftige Unterkunft bestand aus mehrstöckigen Metallbetten und alten Strohsäcken. Das neue Lager trug in der SS-Lagerverwaltung die Bezeichnungen „K.L. Bu. Arbeitskommando Kassel Druseltal 85“ oder „Bauleitung Kassel“. Ausgelegt war es zunächst auf 105 Häftlinge.
Zwangsarbeit
Die Häftlinge arbeiteten für die SS-Bauleitung. Die meisten von ihnen waren zunächst auf zwei Baustellen im Stadtteil Wilhelmshöhe eingesetzt: Am Panoramaweg mussten sie zwei Dienstbaracken mit Luftschutzkeller errichten, an der Straße „An den Eichen“ weitere Dienstgebäude mit Garagen. Daneben erfolgte der Einsatz der Häftlinge in kleinen Gruppen auf anderen Baustellen oder als Hilfskräfte in den Büros der Bauleitung der Waffen-SS in Kassel. Bei Arbeitseinsätzen in der Stadt kamen sie in Kontakt mit der Kasseler Bevölkerung. Als weiterer Arbeitsort ist das Hauptwirtschaftslager der Waffen-SS in den Steinbrüchen von Breitenbach nahe Kassel belegt, wo einige Häftlinge zeitweise auch untergebracht waren.
Die SS wählte die meisten der Männer wegen ihrer beruflichen Qualifikation für den Einsatz in Kassel aus. Unter ihnen gab es viele Elektriker, Installateure, Maurer oder Dachdecker. Die Arbeitszeiten variierten. Im Oktober 1944 wurde etwa von 7:45 bis 16:45 Uhr gearbeitet. Trotz der Zwangsarbeit auf den Baustellen schilderten Überlebende die Verhältnisse im Lager und bei der Arbeit als vergleichsweise erträglich.



Bewachung
Die Bewachung des Lagers und der Arbeitsorte übernahmen ältere Polizisten aus Kassel. Sie standen unter dem Kommando eines Polizeimeisters namens Ritter. Die Buchenwalder SS schickte lediglich einen Kommandoführer mit einem Stellvertreter nach Kassel. Zunächst war dies SS-Oberscharführer Heinrich Best (geb. 1909). Im Oktober 1944 löste ihn SS-Oberscharführer Albert Rudolph (geb. 1905) ab. Als ihre Stellvertreter sind die SS-Unterscharführer Franz Hronizek und Gerhard Heinrich (geb. 1922) belegt. Bei der SS-Bauleitung in Kassel war zudem der zuvor in Buchenwald tätige SS-Hauptscharführer Karl Weyrauch (1911-1984) eingesetzt. Ein amerikanisches Militärgericht in Dachau verurteilte ihn 1947 wegen Verbrechen in Buchenwald zu zehn Jahren Haft. Verurteilungen wegen der Geschehnisse im Außenlager Kassel-Druseltal gab es nicht.
Räumung
Als sich die amerikanischen Truppen Kassel Ende März 1945 näherten, löste die SS das Lager auf. Mit Bussen wurden die Häftlinge zurück nach Buchenwald gebracht. 139 Männer trafen dort am 28. März ein. Zehn Häftlinge blieben in Kassel zurück, um Akten der SS zu vernichten. Dem Bericht des Überlebenden Alfred Frederik Groeneveld zufolge trieben SS-Männer sie anschließend in Richtung Harz. Mit drei Mithäftlingen floh Groeneveld in der Nähe von Nordhausen und erlebte dort die Befreiung durch die amerikanische Armee. Was mit den anderen sechs Häftlingen geschah, ist nicht bekannt.
Spuren und Gedenken
Auf dem ehemaligen Lagergelände am Druseltal stehen heute Privathäuser. Vor Ort erinnert nichts an das Außenlager. Von den Gebäuden, die die Häftlinge errichten mussten, sind nur noch die Dienstbaracken am Panoramaweg erhalten. Der Landesbetrieb HessenForst hat dort heute seinen Sitz. Auf Initiative des Ortsbeirats Bad Wilhelmshöhe wurde vor Ort am Panoramaweg im Juli 2024 eine Tafel zur Erinnerung an die Geschichte des Außenlagers Kassel-Druseltal angebracht.
Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps
Link zum Standort der Gedenktafel auf GoogleMaps

Literatur:
Dietfrid Krause-Vilmar, Kassel-Druseltal, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors, Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 469-471.