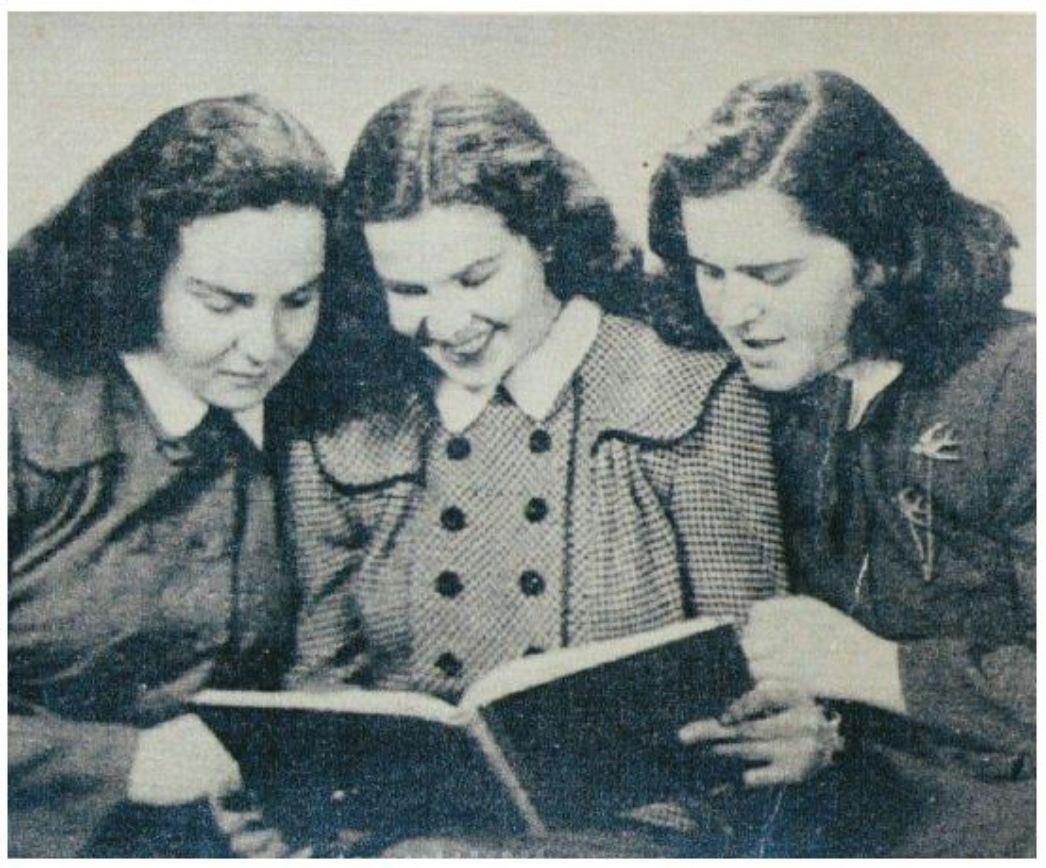
Rachel Hanan wurde am 16. Mai 1929 als fünftes von neun Kindern der jüdischen Familie Cahana in dem rumänischen Dorf Vișeu de Jos geboren. Seit 1940 gehörte der Wohnort der Familie zu Ungarn. Die deutschen Besatzer deportierten Rachel mit ihrer Familie im Mai 1944 nach Auschwitz. Dort sah sie ihre Eltern und ihre beiden jüngsten Brüder zum letzten Mal. Rachel und drei ihrer Schwestern überlebten die Selektion in Auschwitz. Zur Zwangsarbeit brachte die SS sie im September 1944 in das KZ Bergen-Belsen und von dort nach Duderstadt. Die Befreiung erlebten die Schwestern im Mai 1945 in Theresienstadt. Die Schwestern kamen zunächst bei einem Onkel in Budapest unter. Im Juni 1947 wanderte Rachel nach Palästina aus und kämpfte für die Gründung Israels. Sie heiratete 1950 und bekam zwei Söhne. Rachel Hanan lebt heute in Haifa, Israel.
Aus den Erinnerungen von Rachel Hanan
Das Lager Duderstadt
„Nach gut einem Monat, es war Anfang November 1944, brachte uns die SS mit einem Güterzug nach Duderstadt […]. Unser Leben unterschied sich nun deutlich von dem Leben, das wir in Auschwitz gewohnt waren. Wir waren insgesamt 750 Frauen, die in einem Barackenlager auf dem Grundstück einer Möbelfabrik am Stadtrand untergebracht wurden. Die zwei Baracken, die offenbar extra für uns gebaut worden waren, waren von einem etwa zweieinhalb Meter hohen, elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun und einem Bretterverschlag umgeben, sodass man von außen nicht sehen konnte, was sich dahinter verbarg. Die Backsteingebäude waren in Zimmer unterteilt, jede von uns bekam zum Schlafen eine eigene Pritsche mit einem Strohsack und einer Decke, es gab auch eine eigene Baracke mit fließend Wasser, in der wir uns waschen konnten. Welch eine Wohltat!“
Kleidung
„Ich erinnere mich, dass ich einen langen Mantel bekam für den kalten deutschen Winter und neue Schuhe, Holzpantinen mit Lederriemen, für die Arbeit in der Fabrik. Jedes neue Kleidungsstück, das einem zugeteilt wurde, war mit roter Ölfarbe und dem Judenstern markiert. Gegen die Kälte wickelte ich mir Lappen um die Füße, bevor ich sie in die Clogs steckte. Das half auch gegen die offenen, sehr schmerzhaften Druckstellen nach Wochen und Monaten in den harten Holzschuhen.“
Essen
„Auch das Essen war besser als in Auschwitz oder Bergen-Belsen, es gab ein größeres Stück Brot und eine heiße Gemüsesuppe, in der nicht, wie in Auschwitz, nur ein paar Erbsen und vergammelte Kartoffelstücke am Topfboden klebten, die wir sowieso nie bekommen hatten, weil die Wassersuppe immer von oben abgeschöpft wurde. Hier war die Suppe mit Erbsen, Bohnen und Karotten gut bestückt, dafür jedoch so heiß, dass wir nicht genug Zeit hatten, sie auch essen zu können. Wir arbeiteten bis zu 12 Stunden täglich. Auch sonntags, auch am Sabbat, was für mich als gläubiger Jüdin einem Frevel gleichkam. Die Mittagspause wurde mit 15 Minuten so kurzgehalten, dass man sich entweder den Mund an der Suppe verbrannte oder sie, weil zu heiß, stehen ließ und weiter Hunger litt. Nichts durfte die Produktion aufhalten, ein grausames Spiel mit den Bedürfnissen der körperlich und seelisch erschöpften Zwangsarbeiterinnen nach monatelanger Gefangenschaft. ‚Vernichtung durch Arbeit‘, so nannte es die SS. Und das traf es auf den Punkt.“
Zwangsarbeit
„Gearbeitet wurde in zwei Schichten rund um die Uhr. Für die Tagesschicht wurden wir um sechs Uhr morgens von der Wachmannschaft, unter den Augen der SS, in Fünferreihen vom Lager zur Fabrik geführt. Abends gegen 18 Uhr, wenn die Nachtschicht begann, ging es wieder zurück ins Lager. Die Polte-Aufseherinnen waren oft brutale Frauen, die uns lauthals herumkommandierten – ‚Macht schneller, ihr Schweine‘ – und auch mal mit einer Peitsche zuschlugen, die sie mit sich führten. Der größte Unterschied zu Auschwitz oder Bergen-Belsen aber war sicher der, dass wir nicht mehr unmittelbar durch den Tod bedroht waren, wenn man die zunehmende Erschöpfung einmal ausklammerte. Man spürte deutlich, dass die SS in der Fabrik nicht das alleinige Sagen hatte. Die Waffenfabrik war ein Familienunternehmen, das in erster Linie Geschosshülsen und Patronen produzieren wollte und keine toten Jüdinnen. Doch davon einmal abgesehen: Dass wir die Munition, die uns vernichten sollte, selbst herstellten, war ohnehin von besonderer Perfidie.
Jede von uns vier Schwestern bekam in der Fabrik eine andere Arbeit zugewiesen. Ich war in der sogenannten ‚Hülsenproduktion‘ in Halle 17, was den Vorteil hatte, dass dort während der Arbeitszeit oft gar keine Aufseherinnen waren. Offenbar gab es nicht genügend. Meine Aufgabe war die einer menschlichen Harke. 13 Stunden täglich zog ich mit bloßen Händen fertig gebrannte Patronenhülsen aus einem 90 Grad Celsius heißen Ofen, vor dem ich den ganzen Tag kniete. Für mich war es ein Ofen, auch wenn der Vorarbeiter stolz von der ‚Munitionsmaschine‘ sprach. Mein Arbeitssoll waren 2000 Patronen am Tag, waren es weniger, wurde mir damit gedroht, meine spärlich nachgewachsenen Haare wieder abzuschneiden. Später mussten meine Schwestern die Munition abmessen und abschleifen, damit sie in den Waffenzylinder passte.
Die Wochen in der Munitionsfabrik haben die Nervenbahnen an meinen Fingerspitzen beschädigt und dort Hornhaut wachsen lassen, die mich unempfindlich gemacht hat gegen jede Form von Hitze. Bis heute kann ich mit bloßen Händen Fleischbällchen in der Pfanne wenden. Meinen Enkeln habe ich, als sie noch Kinder waren, weißgemacht, ich hätte magische Hände und könnte zaubern. Tatsächlich sind meine tauben Fingerspitzen das Ergebnis meiner Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie.“
Aus: Rachel Hanan mit Thilo Komma-Pöllath, „Ich habe Wut und Hass besiegt“. Was mich Auschwitz über den Wert der Liebe gelehrt hat, München 2023, S. 133 ff.


