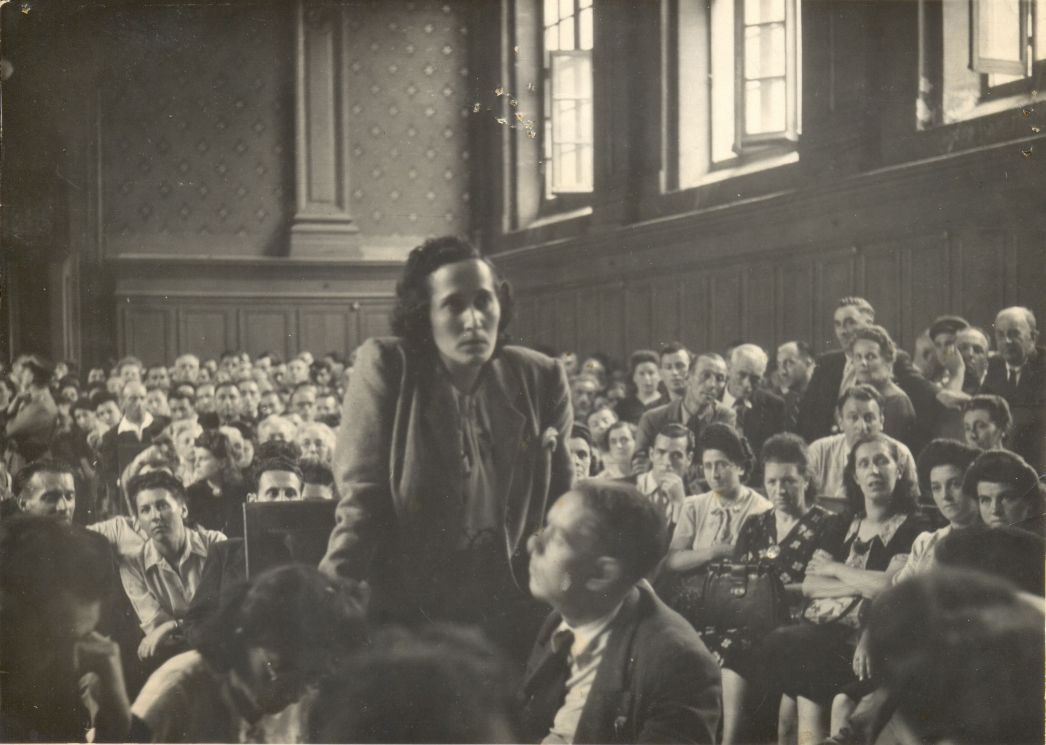
Mercedes Núnez Targa kam am 16. Januar 1911 in Barcelona, Spanien, zur Welt. Sie war in sozialistischen und kommunistischen Jugendorganisationen aktiv. Wegen ihres Widerstandes gegen die Franco-Diktatur wurde sie 1939 inhaftiert. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis floh sie 1942 nach Frankreich. Dort schloss sie sich dem Widerstand gegen die deutschen Besatzer an. Die Gestapo verhaftete sie 1944. Nach Aufenthalten in verschiedenen Gefängnissen und Lagern brachte die SS Mercedes Núnez Targa im September 1944 aus Ravensbrück nach Leipzig-Schönefeld. Bei der Räumung des Lagers blieb sie schwerkrank zurück. Nach der Befreiung lebte sie wieder in Frankreich. Erst nach dem Tod des spanischen Diktators Franco kehrte sie 1975 nach Spanien zurück. Mercedes Núnez Targa starb 1986 in Vigo.
Aus den Erinnerungen von Mercedes Núñez Targa
Ankunft in Leipzig-Schönefeld
„Die Reise war kurz. Wir fuhren erneut in den besagten Viehwaggons, begleitet von dem unausweichlichen Gemeinschaftskübel und dem entsprechenden Gestank. Doch bereits am nächsten Morgen erreichten wir das Ziel unserer Reise, und zwar das in der Nähe von Leipzig errichtete Lager unweit der HASAG-Metallwerke, wo wir zur Arbeit eingesetzt wurden. […]
Sechstausend Frauen waren wir, die bei der HASAG einen Beitrag zur Rüstungsindustrie des ‚Großen Reiches‘ leisten sollten. Sämtliche Nationalitäten Europas waren unter uns vertreten. Es gab Arbeiterinnen und Akademikerinnen, Händlerinnen, Ärztinnen, Bäuerinnen, Offizierinnen der Roten Armee, Frauen aus bescheidenen Verhältnissen und andere aus wohlhabenderen Schichten. Doch ungeachtet aller Unterschiede hinsichtlich Nationalität, sozialer Herkunft, religiöser und politischer Überzeugungen kämpften wir gemeinsam gegen den Nationalsozialismus.
Das Lager war, genau wie in Ravensbrück, von Elektrozäunen und Wachtürmen umgeben. Unmittelbar nach unserer Ankunft, noch bevor wir in den Block gelassen wurden, erfolgte ein Appell. […]
Nach dem Appell ging es endlich zu den Blöcken. Hier gab es eine Pritsche für jede von uns, nicht eine für zwei wie in Ravensbrück. Die Matratze bestand aus dickem, mit Stroh gefülltem Sackleinen. Dazu für jede eine dunkle Decke, wie die beim Militär. Die Betten waren in vier Etagen übereinander angeordnet. Es gab einen Waschraum mit vielen Wasserhähnen, wo wir uns richtig würden waschen können, ohne Seife, versteht sich.“
In der Fabrik
„Die Fabrik war von beeindruckender Größe und stellte Granaten verschiedener Kaliber her. Neben den sechstausend deportierten Frauen arbeiteten dort Kriegsgefangene und zwangsverpflichtete Männer aus allen Ländern Europas sowie eine sehr geringe Anzahl von deutschen – militärisch organisierten – Arbeitern, die im Allgemeinen als Mechaniker oder Techniker eingesetzt waren. Es war offensichtlich, dass die deutsche Kriegsindustrie zu dieser Zeit ausschließlich dank der ausländischen Zwangsarbeitskräfte funktionierte.
Sie ließen uns in Reih und Glied antreten, dann erschien der Obermeister. Als wäre er auf dem Pferdemarkt, musterte er uns von oben bis unten, betastete auch hier und da mal einen Bizeps von uns Frauen. […]
Unser Leben war hart. Eine Woche lang arbeiteten wir von fünf Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags. Vor dem Abmarsch mussten wir zum unvermeidlichen Appell antreten, der jedes Mal mindestens eine Stunde dauerte. Nach unserer Rückkehr ins Lager folgte mindestens eine weitere Stunde Appell, niemals weniger. Mittags wurden wir zum Essen ins Lager gebracht. Schnell die Suppe hinuntergeschlungen und schon ging’s, wiederum in Formation, zurück zum Malochen.
In der folgenden Woche arbeiteten wir von fünf Uhr nachmittags bis fünf Uhr morgens, was uns allerdings nicht die Appelle ersparte. Wir arbeiteten immer im Stehen und verrichteten harte, kräftezehrende und oft sehr gefährliche Tätigkeiten.“
Hunger
„Der Hunger hatte extreme Ausmaße angenommen, aber niemand sprach darüber, weil wir alle in der gleichen Situation waren und es unanständig erschien, sich gegenüber einer anderen Gefangenen zu beklagen, die genauso hungrig war wie man selbst. Jede suchte nach Mitteln und Wegen, den Hunger zu überlisten und gefühlt mehr zu essen, obschon es gar nicht mehr war. Manche teilten die tägliche Scheibe Brot in winzige Stückchen, die sie langsam und in regelmäßigen Abständen zu sich nahmen. Andere hoben etwas von der mittäglichen Suppe auf, um sie am Abend zu essen. Ich organisierte mir eine leere Konservendose und bekam von einer sowjetischen Frau, die in der Küche arbeitete, ein wenig Salz. Ich brach mein kleines Stück Brot in zwei Hälften, versteckte eine Hälfte sorgfältig unter meinem Strohsack und nahm, zusammen mit dem winzigen Stückchen Margarine, das wir täglich erhielten, die andere Hälfte mit in die Fabrik. Neben meiner Maschine befand sich eine Zapfstelle für kochendes Wasser, an der die deutschen Mechaniker sich in der Pause ihren Kaffee zubereiteten. Ich füllte dort meine Dose, fügte Salz, Margarine und meine – in kleine Stücke gebrochene – halbe Brotscheibe hinzu, vermischte alles mit einem Löffel und konnte mir einbilden, eine gute, heiße Suppe zu genießen. Während der folgenden Stunden träumte ich dann von der anderen Hälfte, die ich, sobald ich zurück im Lager war, schnell verschlingen würde.“
Befreiung
„Die Häftlinge zogen in Reihen los, bewacht von Hunden und SS, und wir beobachteten sie vom Fenster aus. Plötzlich öffnete sich die Tür zum Revier, und mit unbeschreiblicher Freude sahen wir Dr. Maria und Dr. Irena eintreten. Sie trotzten der Gefahr, widersetzten sich den Befehlen der Nazis, blieben bei uns und teilten unser Schicksal. […] Ihre Anwesenheit bedeutete nicht nur eine starke moralische Unterstützung, sie war für uns auch überlebenswichtig: Was hätten wir ohne ihre Hilfe getan?
Wir sahen in der Ferne noch immer die Reihen der Gefangenen, als eine sowjetische Frau wie eine Wahnsinnige ins Revier stürmte: ‚Towarischtschi! Towarischtschi!‘ Die Frau schrie, sprach, stammelte, gestikulierte, weinte und lachte zugleich.
Angesichts der ungeheuren Gefühlsausbrüche und der Siegesrufe sämtlicher sowjetischer Frauen begriffen wir, dass gerade etwas Großartiges geschah.
‚Wir sind frei!‘, übersetzte ganz aufgeregt eine Frau, ‚frei, Kameradinnen, frei! Die gesamte SS ist verschwunden.‘
Selbst die bereits im Sterben liegenden Frauen richteten sich in ihren Betten auf. Wir lachten, wir weinten, wir umarmten uns alle gegenseitig. Ich finde noch immer keine Worte, um diesen unvergesslichen Moment zu beschreiben. Ich weiß nur noch, dass mein erster Reflex darin bestand, die kleine republikanische Flagge, die meine spanischen Schwestern so liebevoll gebastelt hatten, schnell hervorzuholen.
Wir schrieben den vierzehnten April neunzehnhundertfünfundvierzig.“
Aus: Mercedes Núñez Targa, Der Wert der Erinnerung, Berlin 2022 [Paris 1967 und Barcelona 1980].


