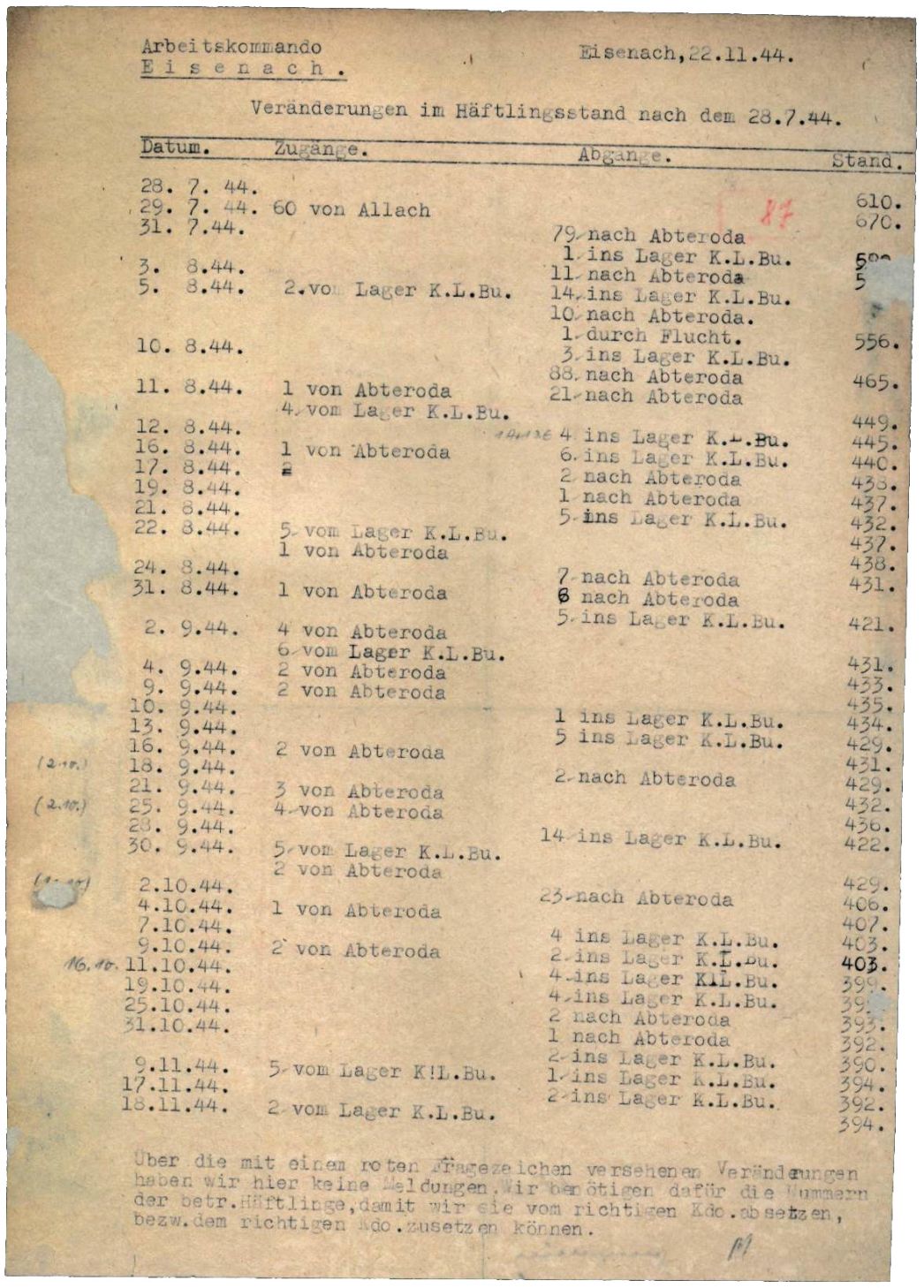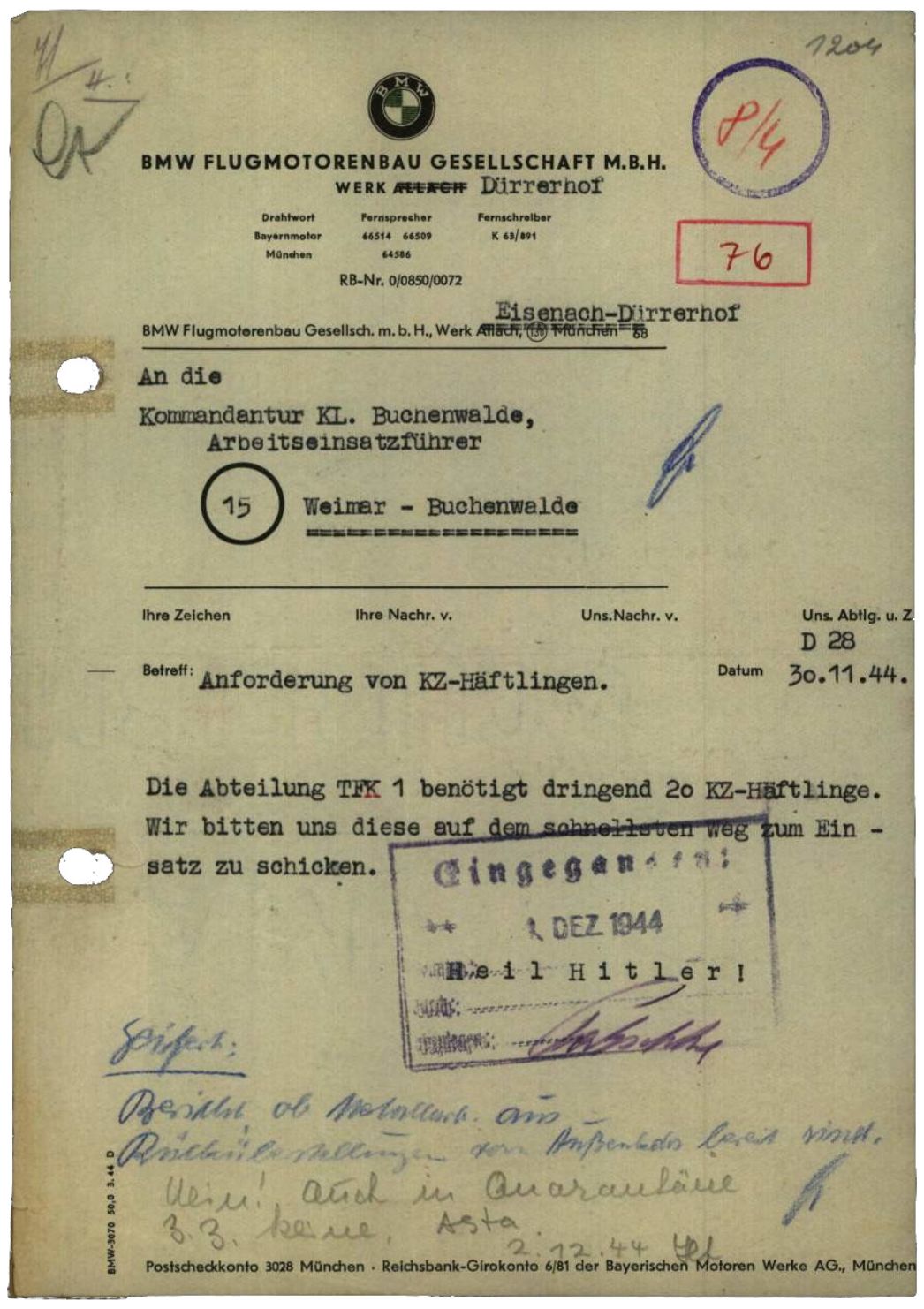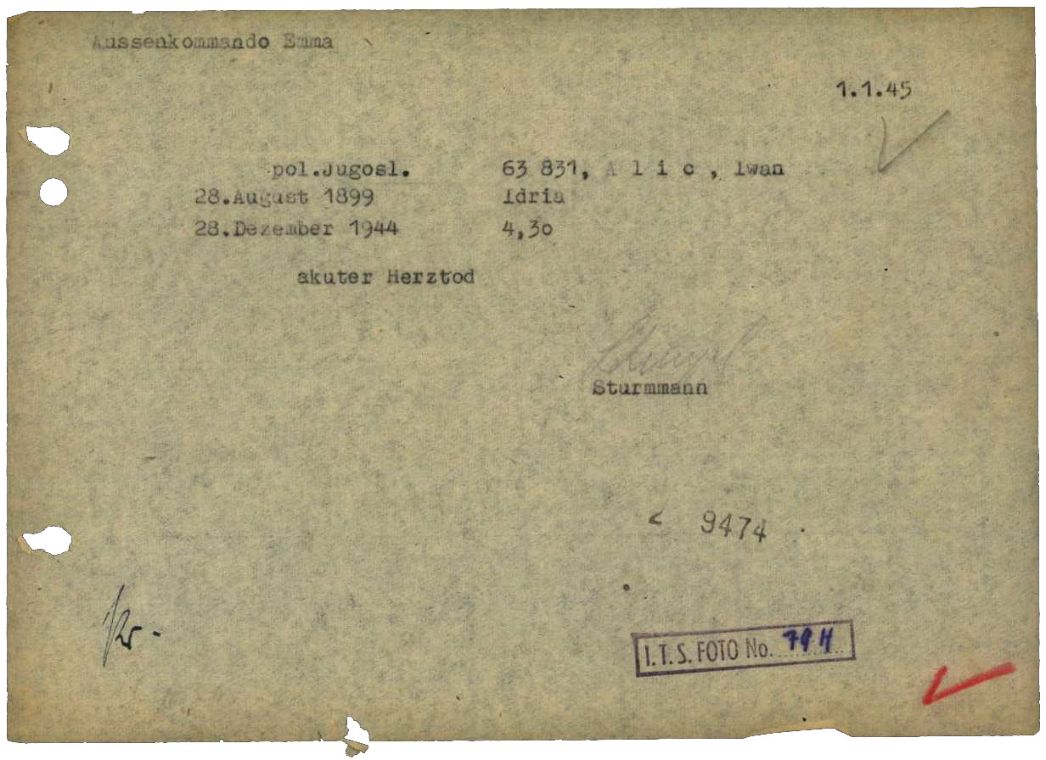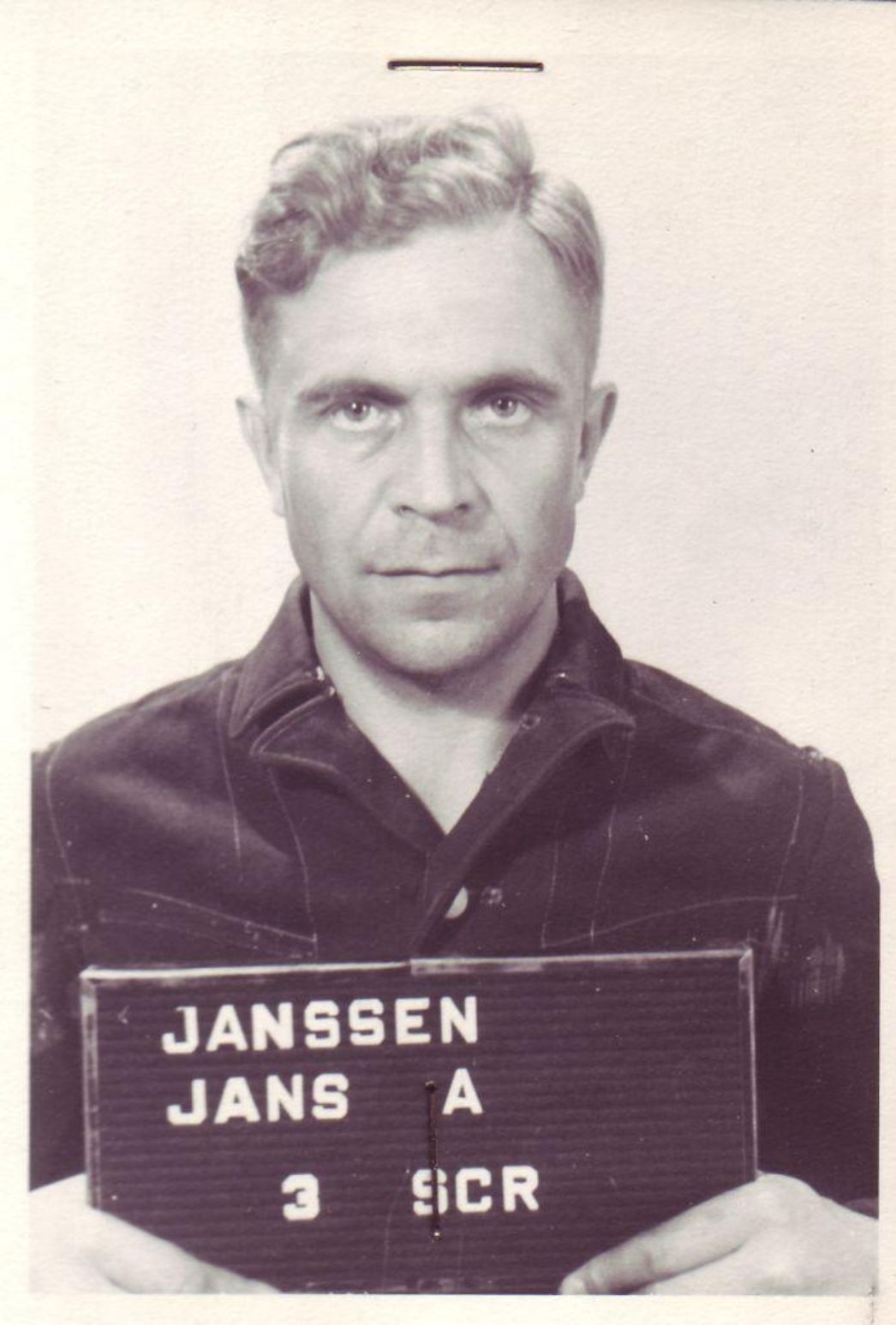Räumung
Die Alliierten bombardierten mehrmals die BMW-Werke in Eisenach. Die letzte Bombardierung fand am 9. Februar 1945 statt und traf einen Teil der Fabrik. Eine Woche später, am 16. Februar 1945, räumte die SS das Außenlager und schickte die Häftlinge zurück in das Hauptlager Buchenwald. Den Großteil von ihnen brachte die SS kurz darauf in andere Außenlager, zum Beispiel nach Schönebeck (NARAG).
Literatur:
Jessica Elsner, Das KZ Außenlager „Emma“ in Eisenach – Zur Geschichte und Rolle des Lagers im Nationalsozialismus und dessen öffentlicher Wahrnehmung in der Wartburgstadt Eisenach, Masterarbeit, Universität Erfurt 2015.
Christian Wussow, Eisenach, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Buchenwald und Sachsenhausen, München 2006, S. 433-434.