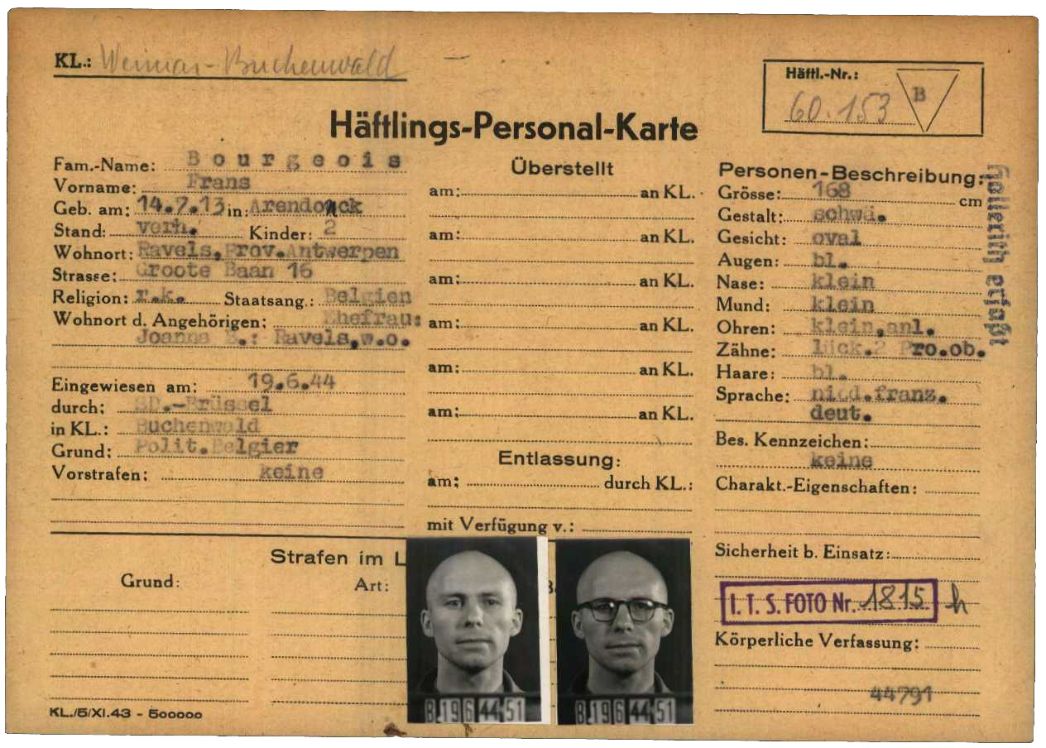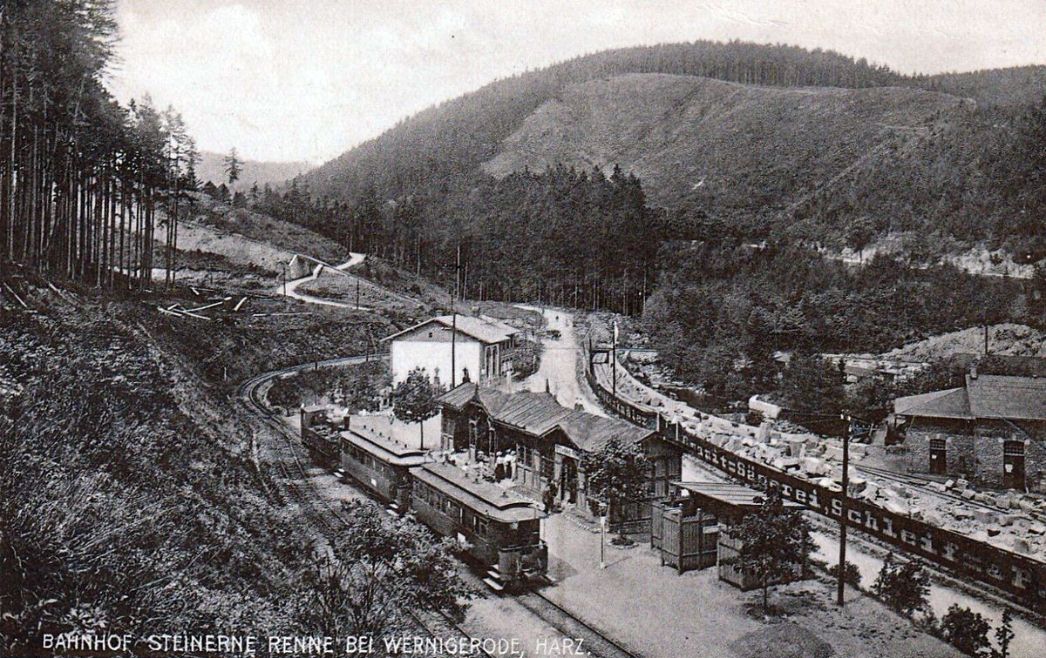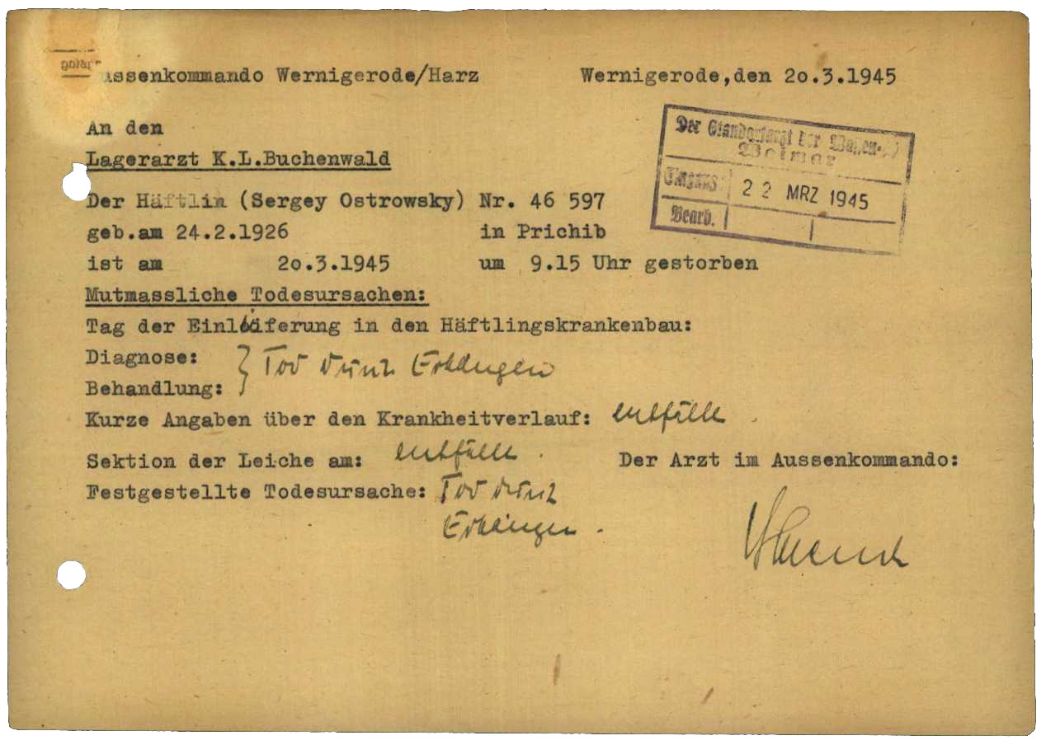Bewachung
Der Kommandoführer in Hasserode war ein nicht näher zu identifizierender SS-Hauptscharführer namens Hantke. Er war seit Juni 1944 bereits Kommandoführer des Außenlagers Wernigerode gewesen. Ein Ermittlungsverfahren der Zentralen Stelle in Ludwigsburg gegen ihn blieb in der Nachkriegszeit folgenlos. Für die Bewachung des Lagers unterstanden ihm circa 50 SS-Wachposten.
Räumung
Am 10. April 1945 löste die SS das Lager auf und brachte die Häftlinge teils zu Fuß, teils mit Zügen ostwärts. Eine erste Gruppe von etwa 300 Häftlingen blieb in Calbe in Sachsen-Anhalt zurück. Amerikanische Truppen befreiten sie dort Mitte April. Die übrigen Männer wurden weiter nach Süden getrieben und Anfang Mai 1945 im tschechischen Leitmeritz und Budejovice befreit. Wie viele Männer unterwegs ihr Leben verloren, ist nicht bekannt.
Literatur:
Mark Homann, Jenseits des Mythos. Die Geschichte(n) des Buchenwald-Außenkommandos Wernigerode und seiner „Roten Kapos“, Berlin 2020.
Franziska Jahn, Wernigerode („Richard“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 606-609.